

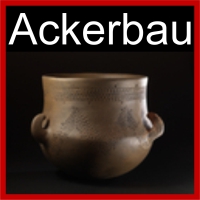








Urnenfelderkultur
1.250 v. Chr. - 800 v. Chr.
Die Urnenfelderzeit erhielt ihre Bezeichnung von einer neuen Bestattungssitte, nämlich der Anlage sogenannter "Urnenfelder". Damit kommt zum Ausdruck, dass in den Friedhöfen der damaligen Gesellschaft Urnen aus Ton niedergelegt wurden, in denen man die Aschereste der verbrannten Toten der Erde übergab. Diese Sitte war allmählichen Änderungen unterworfen; auch regionale Unterschiede der Bestattungsart lassen sich nachweisen.
Größere Gräberfelder der Urnenfelderzeit konnten im Beilngrieser Raum bisher noch nicht entdeckt werden. Dies kann forschungsgeschichtlich bedingt sein und entspräche nicht den tatsächlichen damaligen Siedlungsverhältnissen.
Ein besonderes Merkmal der Urnenfelderzeit ist die Anlage mächtiger, befestigter Burgen auf markanten Bergspornen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Schellenburg auf dem Schellenberg, er sich zwischen Enkering, Kinding und Ilbling erhebt. Man kann dort heute noch zwei Abschnittswälle und einen Ringwall mit Bastionen besichtigen. Ob sich auf dem Bergsporn von Hirschberg zu dieser Zeit ebenfalls eine Befestigungsanlage befunden hat, müssen künftige Forschungen erweisen. Keramikfunde weisen auf eine Nutzung des Bergsporns hin. Vieles dürfte durch die spätere Bebauung gestört sein.

Luftbild des Hirschberger Bergsporns

Lanzenspitze
